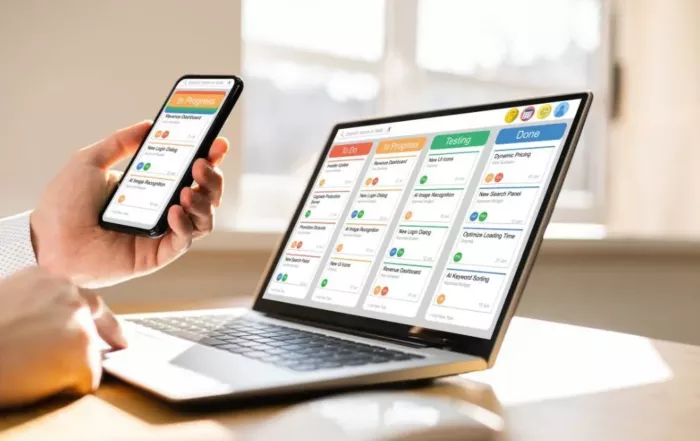Mehr Gewinn durch fokussiertes Projektportfoliomanagement
Effizienz ist gut – Wirtschaftlichkeit ist besser. Viele Unternehmen managen Projekte sauber, aber nicht profitabel. Das TEMPO-Modell zeigt, wie sich Projektportfolios so steuern lassen, dass sie Rendite, Wirkung und Transparenz gleichzeitig erhöhen – und Projektmanagement vom Kostenfaktor zum Gewinnmotor machen.
Warum Profitabilität das neue Leitprinzip im Projektmanagement ist
Projektmanagement hat in den letzten Jahren einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Was früher als notwendige Disziplin galt, um Projekte „in Time, in Budget und in Scope“ zu halten, wird heute zunehmend als strategisches Steuerungsinstrument verstanden.
Doch in der Praxis zeigt sich ein gefährlicher Widerspruch: Viele Organisationen betreiben Projektmanagement mit beeindruckender Präzision – aber ohne wirtschaftliche Perspektive. Fortschritt wird in Prozentpunkten gemessen, nicht in Profitabilität. Budgets werden minutiös eingehalten, doch der tatsächliche Mehrwert für das Unternehmen bleibt oft unklar.
Das Ergebnis ist ein Paradoxon: Projekte werden effizient umgesetzt, aber nicht wirtschaftlich gesteuert. Überlastete Ressourcen, unklare Prioritäten und zu viele parallele Vorhaben führen zu Projektstaus. Teams arbeiten an Aufgaben, die zwar dringend wirken, aber keinen strategischen oder finanziellen Beitrag leisten.
Mit zunehmendem Kostendruck, Fachkräftemangel und gestiegenen Erwartungen von Kunden und Stakeholdern entsteht ein neues Leitprinzip: Profitabilität. Unternehmen müssen Projekte nicht nur richtig, sondern vor allem die richtigen Projekte durchführen – und sie mit Blick auf Rendite, Wirkung und Ressourcenwert steuern.
Projektportfoliomanagement wird damit zu einer unternehmerischen Disziplin. Wer es beherrscht, verwandelt Projekte von Kostenstellen zu Renditetreibern.
Der folgende Artikel zeigt, wie das TEMPO-Modell Unternehmen dabei unterstützt, genau das zu erreichen – mit einem klaren, wirtschaftlich ausgerichteten Steuerungssystem.
Der blinde Fleck im Projektportfoliomanagement – Wirtschaftlichkeit statt Aktivismus
In vielen Unternehmen dominieren operative Steuerungslogiken: Wer ruft am lautesten, bekommt Ressourcen. Projekte starten, weil sie „strategisch wichtig klingen“ – nicht, weil sie nachweislich Wert schaffen.
Die Folge ist ein Portfolio-Überhang: zu viele Projekte, zu wenig Fokus, zu geringe Transparenz. Teams arbeiten parallel an Initiativen, deren Nutzen niemand systematisch misst. Entscheidungen werden aus Gewohnheit, Hierarchie oder Bauchgefühl getroffen.
Das zentrale Problem: fehlende wirtschaftliche Kriterien.
Ohne klare Kennzahlen wie ROI, Deckungsbeitrag, Kapitalbindung oder strategischer Fit fehlt die Grundlage, um Prioritäten auf Basis von Wertbeitrag zu setzen.
Viele Organisationen messen Effizienz – aber nicht Effektivität. Sie kontrollieren Termine und Budgets, aber nicht die Frage, ob das Projekt überhaupt wirtschaftlich sinnvoll ist.
Diese Form des „Projektaktivismus“ ist teuer: Ressourcen werden gebunden, Entscheidungen verzögert und Chancen verpasst. Studien zeigen, dass Unternehmen mit wirtschaftlich gesteuertem Projektportfolio bis zu 30 % höhere Renditen auf ihre Projektinvestitionen erzielen.
Wirtschaftlich denken bedeutet also: Projekte als Investitionen zu führen, nicht als Kostenstellen.
Das erfordert ein Steuerungsmodell, das Komplexität reduziert, Entscheidungsqualität erhöht und den Blick auf Wertschöpfung richtet. Genau das leistet das TEMPO-Modell.
Das TEMPO-Modell – Der wirtschaftliche Ordnungsrahmen für profitables Projektmanagement
Das TEMPO-Modell ist kein weiteres methodisches Framework, sondern ein wirtschaftlicher Steuerungszyklus.
Es schafft Orientierung in komplexen Projektlandschaften und verknüpft operative Steuerung mit unternehmerischer Wirkung.
Die fünf Prinzipien bilden einen geschlossenen Kreislauf:
Transparenz, Engpassorientierung, Modellierung, Planung und Optimierung.
Jedes Element stärkt die Steuerungsfähigkeit – und alle zusammen machen Projektportfoliomanagement profitabel.
T – Transparenz
Definition:
Transparenz bedeutet Sichtbarkeit über alle Projekte, Ressourcen und Budgets hinweg. Jeder Beteiligte erkennt den aktuellen Status, Fortschritt, Kosten und Nutzen – in einer einheitlichen, validen Datenbasis.
Nutzen:
Transparenz ist die Grundlage jeder wirtschaftlichen Steuerung. Nur wer weiß, wo Zeit und Geld eingesetzt werden, kann Prioritäten setzen und rechtzeitig reagieren. Sie ermöglicht faktenbasierte Entscheidungen, verringert Abstimmungsaufwand und erhöht Vertrauen im Management.
Beispiel:
Ein mittelständisches Technologieunternehmen hatte über 60 aktive Projekte – aber keine zentrale Übersicht. Entscheidungen basierten auf Einzelberichten, die Wochen alt waren. Nach Einführung eines zentralen Portfoliotools mit automatisiertem Reporting wurden erstmals Status, Kosten und Nutzen aller Projekte sichtbar. Innerhalb von drei Monaten stoppte das Management fünf Projekte mit geringer Wertschöpfung. Der Ressourceneinsatz sank um 15 %, die Profitabilität des Portfolios stieg messbar.
Kernaussage:
Nur was sichtbar ist, lässt sich steuern – Transparenz ist der erste Schritt zur Wirtschaftlichkeit.
E – Engpassorientierung
Definition:
Jedes System hat eine Engstelle – den Punkt, der seinen wirtschaftlichen Durchsatz limitiert. Engpassorientierung bedeutet, diese Stelle zu erkennen, gezielt zu entlasten und Ressourcen danach auszurichten.
Nutzen:
Statt Ressourcen gleichmäßig zu verteilen, werden sie dort konzentriert, wo der größte Hebel auf Durchsatz, Zeit und Profit entsteht. Das verhindert Aktivismus und sorgt dafür, dass Projekte schneller und rentabler abgeschlossen werden.
Beispiel:
In einem internationalen Konzern analysierte das PMO, warum Projekte regelmäßig Verzögerungen hatten. Die Ursache: fast alle Vorhaben warteten auf IT-Freigaben. Statt mehr Personal zu fordern, wurde der Engpass systematisch optimiert – durch klare Priorisierung, standardisierte Schnittstellen und dedizierte Support-Zeiten. Ergebnis: Die durchschnittliche Projektdauer sank um 20 %, die Umsetzungskapazität stieg deutlich, ohne zusätzliche Kosten.
Kernaussage:
Wirkung entsteht dort, wo der Engpass liegt – Fokus statt Aktionismus.
M – Modellierung
Definition:
Modellierung macht Komplexität sichtbar. Sie bildet die gesamte Projektlandschaft ab, inklusive Abhängigkeiten, Ressourcen und strategischer Gewichtung. Ziel ist es, Szenarien durchzuspielen, Engpässe vorherzusehen und Investitionen gezielt zu steuern.
Nutzen:
Unternehmen verstehen durch Modellierung Ursache-Wirkungs-Beziehungen im Portfolio. Sie können simulieren, welche Kombination von Projekten die höchste Wertschöpfung erzielt – und welche Konstellation zu Überlastung führt.
Beispiel:
Ein Industrieunternehmen nutzte ein Modell, um zu prüfen, was passiert, wenn ein strategisch wichtiges Entwicklungsprojekt um drei Monate verschoben wird. Die Simulation zeigte, dass dadurch zwei margenstarke Kundenprojekte vorgezogen werden konnten – ohne den Gesamtplan zu gefährden. Der Effekt: ein Mehrertrag von über 400.000 Euro und eine Entlastung des Engpasses in der Entwicklung.
Kernaussage:
Modellierung heißt, den Engpass zu erkennen, zu verstehen und gezielt zu verbessern – sie macht Wirtschaftlichkeit steuerbar.
P – Planung der Kapazitäten
Definition:
Kapazitätsplanung bedeutet, Ressourcen gezielt um den Engpass herum zu planen – dort, wo sie den höchsten wirtschaftlichen Nutzen erzeugen.
Nutzen:
Wertorientierte Planung verhindert Überlastung, reduziert Wartezeiten und erhöht den Durchsatz des gesamten Systems. Statt alle Projekte gleichzeitig zu starten, werden sie nach Nutzen, Ressourcenverfügbarkeit und strategischer Relevanz getaktet.
Beispiel:
Ein Konzern stellte seine Portfolioplanung radikal um: Anstatt 40 Projekte parallel zu starten, wurden sie nach wirtschaftlicher Priorität sequenziert. Schlüsselressourcen wie IT-Architekten und Produktexperten wurden gezielt auf die profitabelsten Vorhaben konzentriert. Das Ergebnis: Termintreue +25 %, Ressourcenauslastung stabilisiert, Deckungsbeitrag deutlich erhöht.
Kernaussage:
Wirtschaftlich planen heißt, Ressourcen dorthin zu lenken, wo sie die Profitabilität des Gesamtsystems erhöhen.
O – Optimierung
Definition:
Optimierung steht für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess der Projekt- und Portfoliosteuerung – auf Basis von Ergebnissen, Kennzahlen und Lernerfahrungen.
Nutzen:
Optimierung verankert Wirtschaftlichkeit langfristig. Sie verwandelt Projektmanagement in einen lernenden Prozess, der sich zyklisch verbessert. Dabei geht es nicht um mehr Kontrolle, sondern um mehr Erkenntnis: Welche Steuerungsmaßnahmen wirken? Welche Projekte bringen echten Mehrwert?
Beispiel:
Ein Dienstleistungsunternehmen führte vierteljährliche TEMPO-Reviews ein. Jede Abteilung analysierte, welche Projekte ihren wirtschaftlichen Beitrag tatsächlich erreicht hatten. Auf dieser Basis wurden Prioritäten neu gesetzt, Methoden angepasst und Ressourcen neu verteilt. Innerhalb eines Jahres stieg der durchschnittliche ROI des Projektportfolios um 18 %.
Kernaussage:
Optimierung ist der Motor des TEMPO-Zyklus – sie macht Wirtschaftlichkeit nachhaltig und wiederholbar.
Erfolgsfaktoren und typische Stolperfallen
Das TEMPO-Modell ist wirkungsvoll, wenn Unternehmen es konsequent anwenden – und typische Fehler vermeiden.
Erfolgsfaktoren:
- Einheitliche KPI-Definitionen und wirtschaftliche Bewertungskriterien
- Zentrale Datenbasis und hohe Datenqualität
- Klare Rollen, Entscheidungswege und Verantwortlichkeiten im Portfoliomanagement
- Management-Commitment und gelebte Transparenzkultur
- Kontinuierliche Reviews und Anpassungen auf Basis realer Projektergebnisse
Typische Stolperfallen:
- Zu viele Kennzahlen ohne klare Priorität
- Engpässe werden erkannt, aber nicht aktiv entlastet
- Fehlende Verbindung zwischen strategischem Ziel und operativer Projektsteuerung
- Reviews ohne Konsequenzen oder Nachsteuerung
- Falsche Balance zwischen Kontrolle und Vertrauen
Profitabilität entsteht nicht durch mehr Kennzahlen, sondern durch fokussierte Anwendung wirtschaftlicher Prinzipien.
Das TEMPO-Modell bietet dafür den Handlungsrahmen: Es verbindet betriebswirtschaftliches Denken mit operativer Steuerung – und macht Projektmanagement zu einem echten Renditeinstrument.
Fazit – Profitabilität ist planbar
Projekte sind kein Selbstzweck – sie sind Investitionen in die Zukunft eines Unternehmens.
Doch nur wer den ökonomischen Zusammenhang versteht, kann sicherstellen, dass diese Investitionen auch Rendite erzeugen.
Das TEMPO-Modell liefert dafür eine klare Struktur. Es hilft, Komplexität zu reduzieren, Entscheidungen zu versachlichen und Ressourcen dort einzusetzen, wo sie den größten Beitrag leisten.
Transparenz schafft Klarheit.
Engpassorientierung sorgt für Fokus.
Modellierung ermöglicht Weitblick.
Planung stabilisiert den Durchsatz.
Optimierung macht Erfolge wiederholbar.
Unternehmen, die nach TEMPO steuern, erhöhen ihre Steuerungsfähigkeit, Entscheidungsqualität und ihren ROI. Sie verwandeln Projektmanagement von einem Kostenfaktor in einen messbaren Gewinnmotor – und machen Profitabilität planbar.
Ausführliche Erläuterungen zum TEMPO-Modell, zahlreiche Praxisbeispiele und konkrete Umsetzungsempfehlungen finden sich im Buch „Profitmaschine Projektmanagement“ von Dieter Zibert – https://projektmanagementbuch.de.

Information zum Autor
Dieter Zibert ist Projektmanagement-Experte, Buchautor und Berater. Er zeigt, wie Unternehmen Projekte effizient und profitabel steuern – besonders im Multiprojektmanagement. Mehr unter: https://projektmanagementbuch.de
Related Posts
LETZTE BEITRÄGE
Mehr Gewinn durch fokussiertes Projektportfoliomanagement
Gastautor2025-10-21T12:49:38+00:0021. Oktober 2025|
Kanban im Projektmanagement: Definition, Prinzipien, Vorteile und Grenzen
Beate Schulte2025-10-10T14:06:45+00:009. Oktober 2025|
Welche sind die 10 besten Multiprojektmanagement Software-Lösungen 2025?
Jochen Geißer2025-09-29T10:32:55+00:0012. September 2025|